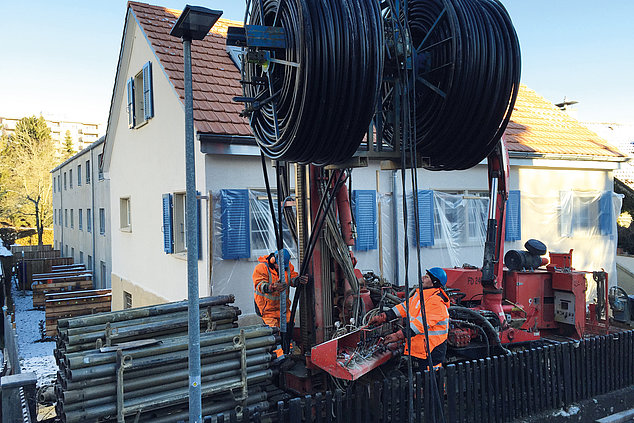CO2-frei für die Zukunft
BaseLink, eröffnet im Sommer 2022, ist ein Technologie-Hub, ein hochmodernes Arbeitsumfeld für Start-ups und etablierte Unternehmen in Allschwil. Als visionärer Standort ist Innovation im Kern des 75‘000 m² Areals verankert. Das breit gefächerte Energiekonzept umfasst auch Geothermie. Dabei werden Grosswärmepumpen mit Erdwärme gespeist – das Sondenfeld dient gleichzeitig als thermischer Speicher. Das komplette Sondenfeld wurde mit leistungsfähigen Erdwärmesonden diffusionsdicht ausgeführt.
Lesen Sie mehr dazu im Referenzbericht
Projektdetails
Versorgung
Geothermie
- Grund-Eigentümer
Bürgerspital, Basel/CH
- Bauherr Energiesystem & Contractor
Primeo Energie, Münchenstein/CH
- Fachplanung
Schädle GmbH, Basel/CH
- Bohrunternehmen
Barmettler Erdenergie, Moosleerau/CH
- Wärmepumpen
Walter Wettstein AG, Gümligen/CH